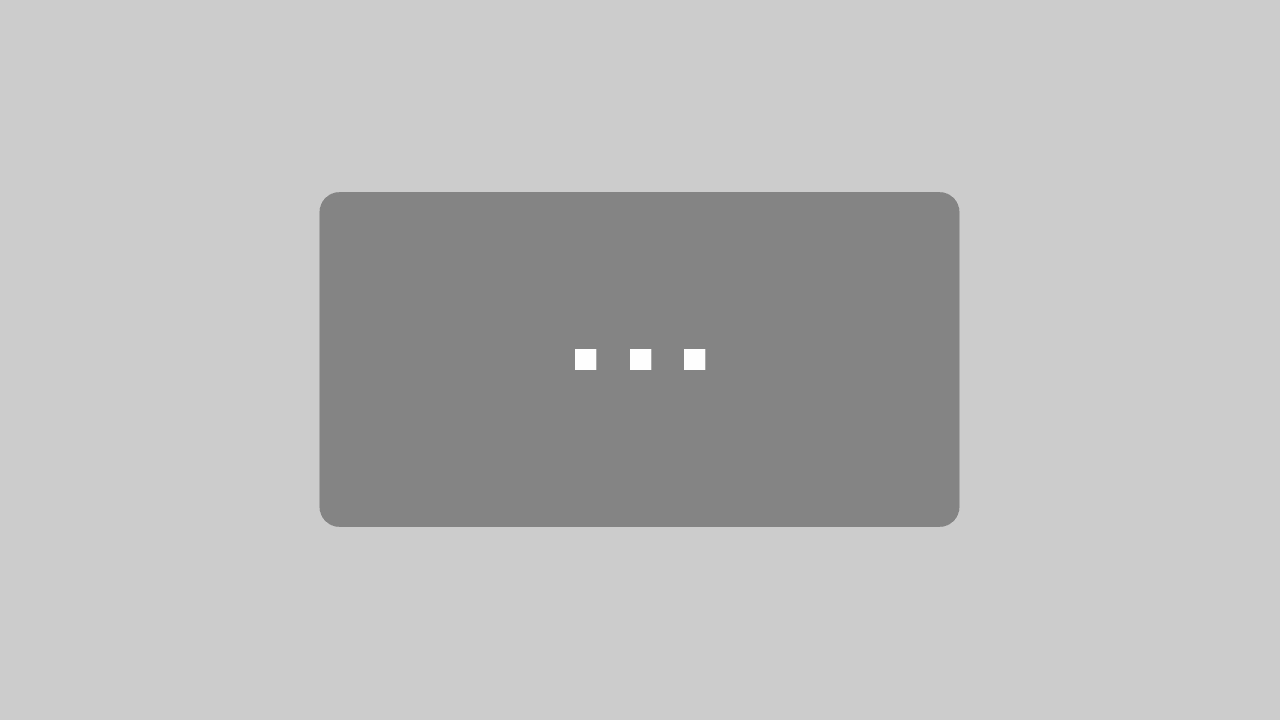Preis der Nationalgalerie für junge Kunst 2011
Preisträger

Cyprien Gaillard
(geboren 1980 in Paris, lebt und arbeitet in Berlin)
Begründung der Jury:
Cyprien Gaillards Film „Artefacts“ ist eine eindrückliche Reflexion über den Mythos Babylon, der durch den Bezug zum Krieg im Irak eine besondere Aktualisierung erfährt. Die kraftvollen, betörenden Bilder sind bewusst so ineinander geschnitten, dass eine hypernervöse, fast hypnotische Wirkung entsteht, die unsere Aufmerksamkeit auf unsere eigene kulturelle Befindlichkeit lenkt. Cyprien Gaillard verfolgt keinen dokumentarischen Ansatz, sondern wirft durch das offene Prinzip der Montage eher Fragen auf über den Verbleib und die Erhaltung unserer Kulturen. Im Mittelpunkt seines Filmes steht die Erosion von Artefakten. Mit der von ihm gewählten stark ästhetischen Form ist der Wille verbunden, eine Tonlage und Sprache zu finden, die außerhalb der konventionellen Berichterstattung in den Medien steht und die damit unsere Wahrnehmung für andere emotionale Räume eröffnet. Cyprien Gaillard hat ein Werk aus suggestiven Bildern geschaffen, in dem das Politische das Kulturelle untrennbar verbunden ist.
Shortlist

Cyprien Gaillard

Klara Lidén

Kitty Kraus

Andro Wekua
Shortlist-Ausstellung
9. September 2011 – 8. Januar 2012
Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin


Auflösung und Zerfall sind die Folgen eines jeden kulturellen Wandels, weil jeder Umbruch mit einem Abschied von Vergangenem verbunden ist. Cyprien Gaillard hat diesen Zusammenhang in seinen bisherigen Fotografien, Filmen und Collagen anhand von Kulturen demonstriert, die gerade von massiven Veränderungsprozessen und damit auch von ebenso starken Verfallserscheinungen geprägt sind. So ist es keineswegs zufällig, dass er sich mit seinem neuen, für den Preis der Nationalgalerie entstandenen Film nun der Stadt Babylon zuwendet, die als älteste Metropole der Menschheit gelten kann, deren Zerfall schon seit Jahrtausenden währt und deren reale Relikte sich auf viele große Museen in der Welt verteilen. Filmaufnahmen vor dem historischen Ischtar Tor in Berlin erscheinen deshalb eng verknüpft mit Aufnahmen vor Ort, im stark vom Krieg gezeichneten Land Irak. Dort macht der Künstler in seinen Aufnahmen keinen Unterschied zwischen aufgelassenen Kultstätten in der Wüste und Neubauten oder Baustellen der irakischen Gegenwart. Alles sind aus seiner Sicht gleichwertige Fundstücke, „Artefakte“, also Hinterlassenschaften des Menschen, die wie in der klassischen Archäologie Rückschlüsse auf eine Kultur und deren Lebensweise erlauben. „Artefacts“, wie der Film schließlich auch heißt, werden im technischen Sprachgebrauch vor allem die Fehler bei der Foto- und Filmherstellung benannt: Farbstiche, Rasterungen, Bilderrauschen und ähnliches. Eben solche „Fehler“ kennzeichnen auch Gaillards Bilder. Bewusst wurde der Film mit dem I-Phone gedreht und erst nachträglich auf das analoge und „noble“ Kinoformat von 35mm umkopiert. Die Projektion betont diesen Anachronismus ebenso wie das fragile Filmmaterial, das im Dauerloop selbst über die Monate hinweg verschleißt und verfällt. Die dazu eingespielte, sich ebenfalls immer wiederholende Musik – ein kurzer Ausschnitt des „Babylon“-Songs von David Grey aus den 1990er Jahren – unterstreicht das gesamte künstlerische Prinzip dieser filmischen Collage. Sie ist weniger dokumentarisch als assoziativ zu begreifen: als vielschichtige Reflexion von Erosionsprozessen in der Kultur.
Kitty Kraus hat für den Preis der Nationalgalerie zwei kinetische Skulpturen geschaffen – eine Novität in ihrem bisherigen Oeuvre. Den materiellen Ausgangspunkt stellen dabei Griffstangen von Einkaufswägen dar. Als isolierte Objekte oder gar von einer Hand umfasst, strahlen die schweren Stangen Macht und eine gewisse Brutalität aus. In den Arbeiten der Künstlerin beschleunigen Motoren diese Stangen und verstärken damit das Gefährdungspotential. Die Bewegungen selbst reichen bis ins Unberechenbare, nehmen gleichzeitig in ihrer permanenten Wiederholung monotone, fast beiläufige Züge an. Mit den Supermarktnamen wie „Plus“ oder „Norma(l)“ kommen Begrifflichkeiten ins Spiel, die über die Shoppingwelt hinaus auf die moderne kapitalistische Gesellschaft verweisen, auf die Mechanismen des Konsums etwa. So ist das sirrende Rotieren der Stangen wie der Grundton einer Gesellschaft zu begreifen, die immer in Bewegung ist, die durch die neuen Telekommunikationsmedien selbst bei einem hohen Tempo angelangt ist. Die exakten Geschwindigkeiten der Arbeiten bleiben allerdings rein visuell nicht bestimmbar. Deshalb sieht die Künstlerin hier eine Parallele zum bargeldlosen Zahlungsverkehr: „Kapital ist im Umlauf, es zirkuliert. Durch die Umwandlung in einen elektrischen Code wird es unsichtbar.“ Unsichtbarkeit zeichnen gerade auch die Glasarbeiten von Kitty Kraus aus: Auf den ersten Blick nimmt man zunächst eher den Raum als das ausgestellte Glas wahr, entdeckt erst die Spiegelungen im Glas, bevor man die genauen Ausmaße des transparenten Objektes erkennen kann. Die Arbeiten stehen damit quer zur heutigen, so stark auf das rein „Visuelle“ und „Optische“ ausgelegten Alltagskultur. Mit den Glasarbeiten lenkt Kitty Kraus die Aufmerksamkeit eher auf tiefer gehende, abstraktere Prozesse unserer Wahrnehmung, etwa den ständig wachsenden Wunsch der Gesellschaft nach mehr Transparenz. Kameras zum Beispiel sorgen an vielen städtischen Plätzen für eine Überwachung des öffentlichen Lebens und bleiben dabei, ähnlich wie die Gläser, fast unsichtbar. Kitty Kraus setzt ihre Gläser stark unter Spannung, biegt wie hier beim Preis der Nationalgalerie eine 6 Meter-Glasbahn bis zum Limit hoch, so dass erneut ein Moment der Gefährdung im Raum steht. Das Glas steht kurz bevor, „sich selbst zu zerstören“, wie die Künstlerin erwähnt. Die spezifische Form der Glasarbeiten hat die Künstlerin von der menschlichen Figur abgeleitet und so nehmen diese schemenhaft Bezug zum jeweiligen Betrachter auf. Letztlich sind alle Arbeiten von Kitty Kraus zutiefst humanistisch, verweisen auf die Endlichkeit und Fragilität des menschlichen Lebens.




Ein verwahrlostes Areal hinter dem Hamburger Bahnhof, von großen Pflanzen überwucherte Gleise. Ein Baucontainer, der scheinbar zurückgelassen wurde und auf anstehende oder vergangene Veränderungen hinweist. Klara Lidén ging in ihrer Arbeit für die Ausstellung von einzelnen Beobachtungen aus, Fundstücken gewissermaßen, die sie in der Nähe des Hamburger Bahnhofs antraf. Baucontainer, erklärt die Künstlerin im Gespräch, sind mehr als Zeichen eines Wandels, sie stellen für sie ein zentrales Symbol Berlins dar – einer Stadt der offenen Potentiale, des beständigen Ausrangierens und der Metamorphosen. Ihr Projekt für den Preis der Nationalgalerie besteht daher in einer höchst widersprüchlichen und in einfachen Erklärungen auch nicht aufzulösenden Skulptur: einem grünen, ganz aus Büschen und Gewächsen geformten Baucontainer, der für die Dauer der Ausstellung im Hof des Museums fest eingepflanzt wird. Die äußere Form wurde mit Eiben aus einer Baumschule geschaffen, das Innenleben stammt von der Künstlerin selbst. Es sind kleinere Büsche, vor allem Ableger von wild wucherndem Unkraut, die Klara Lidén im Stadtraum entdeckte, ausgrub und die nun im akkurat geschnittenen Container zum Kunstwerk aufgewertet werden. Nicht weniger subversiv ist eine filmische Arbeit, mit der die Ausstellung im Hamburger Bahnhof eröffnet: man sieht die Künstlerin am Schreibtisch in einem nüchternen weißen Raum sitzen, einer Art ‚white cube’, bevor sie anschließend vor den Augen der Betrachter im Mülleimer verschwindet. Der prägnante, kurze Film irritiert, gibt Rätsel auf. Man hat das Groteske in Lidéns Filmen bereits mit der Ästhetik des alten Stummfilms, etwa jenen von Buster Keaton, in Verbindung gebracht. Aber die Verblüffung geht tiefer, hinterfragt nicht nur die Rolle des künstlerischen Daseins und die Mechanismen eines Kunstbetriebs (zu dem auch Kunstpreise zählen), sondern vor allem die menschliche Existenz. Alles hat ein Ende. Übrig bleiben, das macht Klara Lidén unmissverständlich deutlich, die Objekte: die Geräte und Apparaturen der Arbeit oder eben die Unkrautbüschel, die jede Kultur besetzen und, langfristig gesehen, auch überwuchern.
In seinem Film „Never Sleep With A Strawberry In Your Mouth“ beschwört Andro Wekua eine Art Geisterhausatmosphäre herauf. In einem vom Sonnenuntergang lichtdurchfluteten Haus am Meer bewegen sich menschliche Figuren seltsam verlangsamt wie Marionetten oder Roboter. Karnevaleske Masken und Kostüme sowie eine grelle Überzeichnung der Farben kreieren eine surreale, märchenhafte Situation. Totenblasse Gestalten, die von dem jugendlichen Hauptdarsteller beim Pianospiel zum Leben erweckt werden, lösen Momente der Bedrohung aus. Beklemmend ist gerade auch die Filmarchitektur angelegt: ein enges Labyrinth aus Gängen und Räumen. Das Außen dringt nur symbolisch, in Form von verschlossenen Fenstern und herunter gelassenen Jalousien in diese Welt der Isolation. Anlässlich des Preises der Nationalgalerie hat Andro Wekua darüber hinaus eine Skulptur geschaffen, die eine liegende menschliche Figur und das Modell eines Hauses miteinander verbindet, indem ihr Kopf im Inneren des Hauses verschwindet. Wie so oft in Andro Wekuas Arbeiten speisen sich seine Assoziationen aus Filmzitaten und vor allem aus persönlichen Erinnerungsbildern. Wekua ist in Sochumi aufgewachsen, dem ehemaligen mondänen Badeparadies an der Riviera des Schwarzen Meeres, in dem Stalin und Chruschtschow ihre Sommersitze hatten und an dessen riesigen Strandpromenaden Pianospieler an weißen Flügeln saßen und die High Society der sozialistischen Bruderstaaten unterhielten. Der brutale Bürgerkrieg von 1992, in dessen Folge auch die Familie Wekuas das Land verließ, hat Sochumi in eine heute vom Westen und Osten gleichermaßen abgeschnittene Geisterstadt verwandelt. Andro Wekua: „Bei meiner Arbeit handelt es sich um den Versuch, etwas Künstlich-Natürliches zu kreieren – künstliche Figuren, die mit etwas Realem zu tun haben. Ich kann manche Dinge scharf sehen, während ich andere nur verschwommen wahrnehme. Wenn mir jemand sagt, dass ich mir eine Erinnerung nur angelesen habe und diese keinem wahren Erlebnis entspricht, dann bin ich fast bereit, es zu glauben. Diese Dinge befinden sich an der Grenze zwischen Erinnerung und Traum – schon weil sie nur in Fragmenten vorhanden sind.“


Preisträger Preis für junge Filmkunst
Theo Solnik mit dem Film „Anna Pavlova lebt in Berlin“
Begründung der Jury:
In seinem Film beschreibt Theo Solnik die Jugend- und Partykultur des Nachwende-Berlins, ohne konkrete Ereignisse oder Veranstaltungen zu zeigen. Im Zentrum der filmischen Erzählung steht vielmehr die schillernde Figur „Anna Pavlova“, eine junge, vitale Frau aus Russland, die mit der Kamera bei ihrer permanenten Bewegung durch Straßen, Plätze, Parks begleitet wird. In ihrer Rastlosigkeit und ihrer verzweifelten Suche nach etwas Lebensglück strahlt die Protagonistin eine Verlorenheit aus, die einerseits sehr authentisch wirkt, andererseits ganz offensichtlich konstruiert ist. Eine direkte Kontaktaufnahme mit der Kamera, sogar Dialoge mit dem Kameramann entlarven den scheinbar so dokumentarischen, ganz in schwarz-weiß angelegten Film als eine bewusste Inszenierung. In mehrfacher Weise verschränken sich im Film die Wirklichkeitsebenen bei gleich bleibender Intensität der Bilder. Diese auch hohe emotionale Qualität des Films liegt nicht zuletzt in einer, für einen jungen Filmemacher beeindruckend souveränen Handhabung der technischen Mittel. Die Kameraführung allein wechselt virtuos zwischen journalistischem Porträt und freier, poetischer Umschreibung. Als ausgesprochen künstlerisch kann schließlich die ästhetische Gesamtstruktur gelten: eine schier endlos mäandernde Erzählung aus dichten, sich immer wieder ähnelnden Großstadt-Episoden.
Erste Jury
Mechthild Holter
Matthias Mühling
Christiane Meyer-Stoll
Gregor Jansen
Burghart Klaußner
Chus Martínez
Rein Wolfs
Zweite Jury
Bice Curiger
Bartomeu Marí i Ribas
Britta Schmitz
Ann Goldstein
Udo Kittelmann